
Atheuuune
- Magazin der Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Menü
Textgröße
T
T
Textart
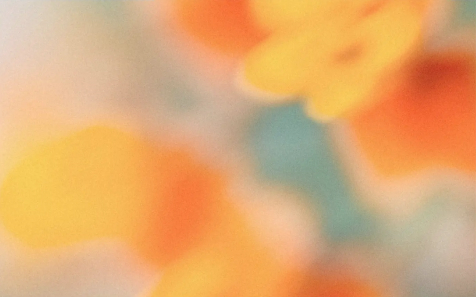
Fälschungen gibt es sowohl in den Natur- wie auch den Geisteswissenschaften: Bei ersteren manifestieren sich diese in Form von wissenschaftlichem Fehlverhalten, bei letzteren z. B. in Form von gefälschten Werken der Bildenden Kunst, der Literatur oder der Musik. Auch wenn in der Bildenden Kunst teilweise selbst mit den Mitteln der Täuschung gearbeitet wird – man denke beispielsweise an die realistische Malerei, in der die Anwesenheit von eigentlich abwesenden Dingen in täuschender Weise suggeriert wird –, ist dies dort nicht nur ausschließlich solange legitim, als dieser Schein transparent gemacht wird, das Publikum also nicht dauerhaft geblendet wird, sondern die Enthüllung ist zudem Teil des Kunstgenusses: Nur weil die Betrachterinnen und Betrachter erkennen, dass es sich um eine Täuschung handelt, können sie deren Qualität einschätzen und würdigen.
Ein wesentlicher Unterschied bei der Auseinandersetzung mit Fälschungen in Natur- und Geisteswissenschaften liegt sicherlich zudem in den Urheberinnen und Urhebern begründet: Während diese im Fall der Naturwissenschaften, wie gleich anhand eines Beispiels zu sehen sein wird, mit der Fachgemeinschaft mehr oder weniger identisch sind, stammen die Fälschungen im Fall der Geisteswissenschaften häufiger (wenngleich durchaus nicht immer) von wissenschaftsexternen Akteurinnen und Akteuren, die zudem weniger primär auf die Wissenschaft als vielmehr auf den Handel abzielen.
Vielleicht aufgrund dessen, vor allem aber wohl wegen angenommener grundsätzlicher Unterschiede zwischen den Fachkulturen – es ist häufig auf den Umstand hingewiesen worden, dass Natur- und Geisteswissenschaften gleichsam auf verschiedenen Instrumenten recht unterschiedliche Melodien spielen –, wurde bislang noch nicht der Versuch unternommen, von deren unterschiedlichen Warten aus analytisch und vergleichend auf die jeweils bei ihnen anzutreffenden Formen der Fälschung zu schauen. Meine Kollegin, die Astronomin Eva Grebel, und ich sind daher umso dankbarer, dass wir im Wintersemester 2018/19 im Rahmen eines Projekts am Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg gemeinsam einen solchen vergleichenden Blick tätigen durften, von dessen gemeinsam erarbeiteten Ergebnissen ich hier stellvertretend für uns beide berichte.
Denn tatsächlich vermag so jede Fachkultur für sich neue Erkenntnisse zu gewinnen: Mir als Geisteswissenschaftler und Kunsthistoriker z. B. wurde durch den vergleichenden Blick in die Naturwissenschaften deutlich, wie (ungeahnt) groß die Parallelen zwischen Kunstfälschungen und Wissenschaftsfälschungen tatsächlich sein können. Zugleich wurde mir bei dem Vergleich der verschiedenen Disziplinen auch äußerst anschaulich vor Augen geführt, dass die Reduktion von möglichen Anreizen (wie z. B. der Lukrativität) einer der Hebel sein kann, über die man Fälschungen am ehesten in den Griff bekommen könnte. Dies mutet zwar vielleicht auf den ersten Blick als scheinbar banale Einsicht an – gerade aber, wenn man sich Fächer anschaut, in denen Fälschungen aus eben dem Grund der mangelnden Rentabilität so gut wie gar nicht vorkommen, wird einem der durchschlagende Effekt solch mangelnder Motivationen äußerst konkret und anschaulich vor Augen gestellt.
Damit deutet sich für beide Fachkulturen die Chance an, dank eines vergleichenden Blicks nicht nur erkennen zu können, dass und in welcher Form es Parallelen auf der Ebene der Phänomene und der daraus resultierenden Probleme gibt, sondern auch hinsichtlich möglicher Lösungsansätze. Zu diesem Zweck sollen im Folgenden, basierend auf den von Frau Grebel und mir angestellten Betrachtungen, schlaglichtartig zum einen die Motivationen und Strategien sowohl der Inverkehrbringung von Fälschungen als auch von deren Entlarvung und Prävention betrachtet werden; zum anderen sollen auch die Schäden, welche die jeweiligen Fälschungen in Kunst und Wissenschaft anrichten können, thematisiert werden. Auf der Grundlage dieser betrachteten Punkte sollen zuletzt ein kurzer Ausblick getätigt und weiterführende Fragen formuliert werden.
Im Bereich der Naturwissenschaften lässt sich hier eine ganze Reihe an Motivationen auflisten wie z. B. der Wunsch, die Realität korrigieren zu können: Experimente liefern nicht immer das gewünschte Ergebnis, weshalb die entsprechenden Daten manipuliert und ver- bzw. gefälscht werden. Dahinter können wiederum Geltungs- und Ruhmessucht oder auch der Druck stehen, Erfolge präsentieren zu können, um den Erhalt von Forschungsmitteln zu legitimieren bzw. zu sichern. Begünstigt werden kann ein solches Verhalten durch die überhebliche Überzeugung, dass man bei dem Betrug sowieso nicht ertappt werde.
Ein prägnantes Beispiel für solche Motivationen bietet der Fall von Jan Hendrik Schön, einem 1970 geborenen deutschen Physiker, der auf den Gebieten der Nanotechnologie und Festkörperphysik forschte. Hier schienen dem 31-Jährigen ab dem Jahr 2001 in rasanter Folge bahnbrechende Ergebnisse zu gelingen, die er in entsprechend dichter Frequenz (im Durchschnitt jede Woche in einem Artikel) bei renommierten Fachzeitschriften wie „Nature“ und „Science“ publizierte. Im selben Jahr wurden jedoch im Fachkollegium erste Zweifel an diversen Veröffentlichungen laut, da dort mitgeteilte Messdaten – ganz im Sinne des Titels dieses Beitrags – zu „schön“, d. h. zu exakt schienen und zudem gelegentlich sogar im Widerspruch zu allgemein akzeptierten physikalischen Erkenntnissen standen. Eingehendere Untersuchungen zeigten schließlich, dass der junge Physiker z. T. die immer gleichen Messkurven zur Dokumentation angeblich völlig verschiedener Experimente verwendet hatte. Zudem waren, wie nach der Entlarvung seiner Fälschungen erkannt wurde, einzelne dieser Messreihen per Computersimulation erstellt worden.
Eine von seinem Arbeitgeber, den Bell Laboratories in New Jersey, eingesetzte Untersuchungskommission kam 2002 zu dem Ergebnis, dass Schön in 16 Publikationen wissenschaftliches Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Dieser gestand darauf, dass die von ihm angegebenen Daten in vielen Fällen fehlerhaft seien, begründete dies jedoch mit angeblichen Verwechslungen sowie der vermeintlichen Notwendigkeit, einzelne Daten im Interesse einer prägnanteren Vermittlung des in den Experimenten Beobachteten angepasst haben zu müssen. Der Überführte verlor daraufhin nicht nur seine Stelle, sondern ihm wurden auch wegen „unwürdigen Verhaltens“ der 1997 erworbene Doktortitel sowie mehrere Auszeichnungen aberkannt. Zudem wurden einige seiner Artikel zurückgenommen (allein „Science“ zog

insgesamt acht Veröffentlichungen Schöns wurden zurückgezogen, „Nature“ sieben dieser Publikationen. Jenseits der hier anzutreffenden Beweggründe kann eine weitere im Bereich der Naturwissenschaften anzutreffende Motivation die Rache an Kolleginnen oder Kollegen sein, die man u.a. mit Hilfe eigens zu diesem Zweck fingierter Daten zu diskreditieren versucht. Einen Sonderfall stellt schließlich der „Hoax“ (englisch für „Jux“, „Scherz“) dar, bei dem gefälschte Daten mit der Absicht vorgelegt werden, die Wachsamkeit der eigenen Wissenschaftsgemeinde auf den Prüfstand bzw. diese eben gerade bloßzustellen: Der Hoax legt es also auf seine Entlarvung an; misslingt diese durch andere, muss die Autorin bzw. der Autor des Hoax dies selbst vornehmen.
Der 1974 geborene amerikanische Chirurg Mark G. Shrime schickte z.B. 2017 unter den offensichtlich fingierten Autorennamen „Pinkerton A. LeBrain“ und „Orson Welles“ einen mit Hilfe eines Computergenerators erstellten Unsinns-Beitrag namens „Cuckoo for Cocoa Puffs?“ (Untertitel: „The surgical and neoplastic role of cacao extract in breakfast cereals“) an 37 vermeintliche „Fach“-Zeitschriften, von denen 17 den Text tatsächlich zur Publikation akzeptierten. Shrime entlarvte den Hoax sodann und verdeutlichte auf diese Weise, wie unseriös jene sich zwar einen wissenschaftlichen Anstrich gebenden, tatsächlich aber teilweise höchst anrüchigen Organe sind, die sich die Publikation derartiger Artikel bezahlen lassen.
Zu all dem lässt sich aus der Sicht der Kunstgeschichte eine ganze Reihe von Parallelen beobachten: Die Korrektur der Realität spielt auch hier in vielerlei Hinsicht eine Rolle. So schuf der Restaurator Lothar Malskat (1913–1988) im Jahr 1937 mittelalterliche Wandbilder im Dom zu Schleswig kurzerhand neu, nachdem er bei einer begonnenen Restaurierung nur noch Reste der originalen Ausstattung vorgefunden hatte. Da er nicht wusste, dass diese bei einer vorangegangenen Restaurierungskampagne bereits 1890 stark beschädigt worden war, fürchtete er, für den Verlust verantwortlich gemacht zu werden. Seine Person demonstriert zugleich die Fluidität der Motivationen, denn er fungiert auch als Beispiel für die Fälschung aus Freude am Betrug: 1948 fälschte Malskat im Chor der Kirche St. Marien in Lübeck weitere mittelalterliche Wandbilder, behauptete jedoch, nachdem der Betrug aufgeflogen war, irreführenderweise, dass nicht nur diese, sondern auch noch zahlreiche weitere Teile der Kirchenausmalung von ihm stammten und mithin falsch seien, obwohl dies nachweislich nicht zutrifft. Als Beweggrund für diese Behauptung kann Ruhmessucht ausgemacht werden, da Malskat sich so öffentlichkeitswirksam mit einer von ihm tatsächlich gar nicht begangenen, spektakulären Tat brüstete.
Natürlich spielt aber auch das Motiv der Gewinnsucht bei Kunstfälschungen häufig eine Rolle, das sich dabei gleichwohl mit weiteren Triebfedern mischt: Der holländische Maler Han van Meegeren (1889–1947) hatte 1937 mit einer Fälschung im Stil des Barockmalers Jan Vermeer (1632–1675) aus Rache zunächst einen ihm nicht gewogenen Kunstkritiker diskreditieren wollen, sah dann jedoch, wie lukrativ der Verkauf seiner Falsifikate war, weshalb er weiterfälschte.
Und auch hier gibt es den – freilich sehr seltenen – Sonderfall des „Hoaxes“: Der britische Maler Tom Keating (1917–1984) fälschte über Jahrzehnte hinweg mehr als 2000 Gemälde von über 160 Künstlern in der Hoffnung, dass die Fälschungen auffliegen und den von ihm verachteten Kunstmarkt verunsichern und destabilisieren würden. Der Prozess, der nach einer sehr verspäteten Entlarvung 20 Jahre nach Beginn seiner Aktivität gegen Tom Keating geführt wurde, wurde 1979 aufgrund seiner stark angeschlagenen Gesundheit eingestellt. Da er seine Motivation in den Augen der Öffentlichkeit scheinbar glaubhaft darlegen konnte, erhielt er sogar eine zwischen 1982 und 1984 im britischen Fernsehen ausgestrahlte, sehr populäre Serie, in der er sein Wissen über die Techniken berühmter Maler vermittelte (Abb. 3).
Wie im Fall von Jan Hendrik Schön gesehen, stießen dessen vermeintlich bahnbrechende Erkenntnisse zunächst auf offene Ohren, was dadurch bedingt war, dass sie nicht nur im Hinblick auf deren Autor, sondern auch auf die Fachgemeinschaft als scheinbare „Wunscherfüller“ fungierten, d.h. sie antworteten augenscheinlich auf existierende Desiderate. Daher konnte Schön zunächst sogar äußerst renommierte Fachzeitschriften als Einfallstore für seine Fälschungen missbrauchen. Umso problematischer sind in diesem Zusammenhang die von Shrime mit seinem Hoax bloßgestellten pseudowissenschaftlichen Zeitschriften, die sogenannten „predatory journals“, deren Geschäftsmodell u.a. darauf beruht, dass sie bereit sind, jedweden Artikel gegen Bezahlung zu veröffentlichen.
Aus der Sicht der Kunstgeschichte lassen sich auch hier Parallelen beobachten. So legte auch der bereits erwähnte van Meegeren seine Fälschungen als „Korrektur der Realität“ und damit als „Wunscherfüller“ an, indem er der Forschung das gab, wonach sie lange gesucht hatte: Immer wieder war darüber spekuliert worden, dass der Maler Jan Vermeer mehr als die bis dahin bekannten religiösen Gemälde geschaffen haben musste. Der Fälscher bestätigte diese Annahme nun nicht nur scheinbar, indem er ein vermeintlich weiteres Werk Vermeers mit religiöser Thematik lieferte, sondern er machte dieses dadurch noch zusätzlich interessanter, dass es eine weitere Annahme der Wissenschaft zu belegen schien: Immer wieder war gemutmaßt worden, ob Vermeer Italien besucht haben mochte und das von van Meegeren gefertigte Gemälde bestätigte dies scheinbar, indem es klare Anlehnungen an bekannte Bilder des italienischen Malers Caravaggios, eines Zeitgenossen Vermeers, aufwies.
Die damit geleistete Suggestion fällt unter jenen Effekt, den man in der kunsthistorischen Fälschungsforschung als „subjektive Verfälschung“ bezeichnet, bei der an dem in Umlauf gebrachten Objekt materiell nichts verändert wird, jedoch dessen Rezeption durch solche Bezugnahmen auf andere Werke oder aber auch durch eigens gefälschte begleitende Dokumente gelenkt werden soll. Ein Meister in dieser Hinsicht war der 1948 geborene Brite John Drewe, der die Fälschungen des in seinem Auftrag arbeitenden Malers John Myatt in Kataloge hineinschmuggelte, die Drewe eigens zu diesem Zweck manipulierte: So stahl er entsprechende ältere Literatur aus kunsthistorischen Spezialbibliotheken und ergänzte die Bände entweder mit entsprechenden Einträgen zu den Fälschungen Myatts oder druckte sie gleich ganz neu. Die solcherart verfälschten Originale bzw. neuerstellten Surrogate brachte er sodann heimlich wieder an ihren ursprünglichen Aufstellungsort zurück. Konsultierte nun jemand den Katalog, um zu überprüfen, ob ein von Drewe angebotenes Kunstwerk bereits Jahrzehnte zuvor schon einmal in einem renommierten Kontext ausgestellt worden war, so wurde dies nun vermeintlich bestätigt.
Die zum Zweck der Irreführung vorgenommene Ergänzung der Kataloge kann als „objektive Verfälschung“ bezeichnet werden, wie sie auch und gerade hinsichtlich von Kunstwerken selbst im Fälschungskontext beobachtet werden kann: Ein zweit- oder drittklassiges Werk z.B. der Renaissance kann dabei so über-restauriert werden, dass es als ein vermeintliches Meisterwerk eines bedeutenden Künstlers der Epoche erscheint. Der Begriff wird jedoch auch dafür verwendet, wenn ein neu geschaffenes Werk durch nachträgliche künstliche Alterung und hinzugefügte falsche Signaturen als Schöpfung einer anderen Zeit und anderer Hände ausgegeben werden soll. Nicht selten werden solche, sich dadurch als vermeintlich kostbar ausweisende Objekte sodann auch (und in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt gerade im Online-Handel) als scheinbar unerkannte „Schnäppchen“ ausgegeben.
Solchen „objektiven Verfälschungen“ in der Kunstgeschichte würden in den Naturwissenschaften die erfundenen bzw. manipulierten Daten Schöns entsprechen; „subjektiver Verfälschung“ begegnet man dort in Fällen, in denen Forschende aus experimentell gewonnenen Daten nur diejenigen präsentieren, welche bestimmte Hypothesen stützen bzw. mit dieser Absicht die entsprechenden Ergebnisse tendenziös interpretieren oder in irreführender Weise kontextualisieren.
In den Wissenschaften generell werden seit langem verschiedene Verfahren zur möglichen Entlarvung von Fälschungen angewendet: So gibt es Peer Reviews für Fachartikel, die deren Qualität prüfen sollen, sowie Plagiats-Softwares. Die zur Bedingung von Fördermitteln gemachten Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis sowie Ausschüsse zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens sollen gleichermaßen als Instrumente der Entlarvung wie der Prävention fungieren. Auf ihrer Grundlage verhängte und nach Außen kommunizierte Sanktionen im Fall einer Überführung haben, wie der Fall von Schön zeigte, auch den Effekt, dass Fachgemeinschaft wie Öffentlichkeit anschaulich demonstriert wird, dass ein entsprechendes Verhalten nicht toleriert und stattdessen geahndet wird. Hierzu gehören im Bereich der Naturwissenschaften auch Positiv-/Negativ-Listen von Zeitschriften, mit deren Hilfe das Florieren von „predatory journals“ verhindert werden soll.
Die ohnehin seit einiger Zeit wissenschaftsübergreifend zur Pflicht gemachte Archivierung und Zugänglichmachung von Forschungsdaten kann im Feld der Naturwissenschaften zudem den Hintergrund haben, dass damit auch die Voraussetzung dafür geschaffen wird, Experimente wiederholbar zu machen, wozu auch die Bereitstellung von Mitteln gehört, um auch und gerade teure Studien reproduzierbar zu machen. Zuletzt nicht unterschätzt werden sollte hier auch der Schutz von seriösen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern auf wissenschaftliches Fehlverhalten, den sogenannten „Whistleblowern“, die bislang nicht selten unter den Folgen ihrer Entscheidung zu leiden haben, tatsächlich bestehende Missstände aufzudecken.
Auf der Ebene der Entlarvung lassen sich in der kunstgeschichtlichen Fälschungsforschung Verfahren wie die Stilkritik sowie die Prüfung der Herkunft eines Objektes nennen (wie der Fall von Drewe und Myatt jedoch zeigt, antizipieren Fälscher diese Schritte bereits). Beide Methoden stehen allerdings oft am Beginn eines Eingangsverdachts, zu dessen Überprüfung sodann auch naturwissenschaftlich-technische Analysen der im Kunstwerk nachweisbaren Stoffe und deren Verarbeitung eingesetzt werden. Da diese Untersuchungen jedoch zeitlich wie technisch aufwändig und damit auch kostspielig sind, werden sie meistens nur bei bereits bestehendem Eingangsverdacht angewendet. Ein probates Mittel zur raschen Entlarvung von Kunstfälschungen ist dabei sicherlich auch die frühzeitige Einbeziehung der Kunstfälschung als Thema in die akademische Ausbildung, denn die Fälle der Vergangenheit haben immer wieder gezeigt, dass selbst namhafteste Sachverständige auf die Konfrontation mit Kunstfälschungen schlichtweg nicht vorbereitet waren. Zu diesem Zweck wurde im Frühjahr 2021 „HeFäStuS“, die Heidelberger Fälschungs-Studien-Sammlung am Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg, gegründet, wo sich Studierende im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit aus polizeilichen Asservatenkammern stammenden Kunstfälschungen analytisch auseinandersetzen und so entsprechend ihren Blick und ihr Wissen schulen können.
Zur Prävention gehört jedoch auch hier die entsprechende Ahndung von aufgedeckten Fällen. Als Pendants zu den für die Naturwissenschaften vorgenannten Punkten ließe sich hier sagen, dass es zwar wünschenswert wäre, wenn es – in Analogie zu den „Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis” – auch entsprechend strenge Richtlinien für den Kunstmarkt gäbe. Allerdings lebt dieser gerade von einer gewissen Diskretion und auch bedingten Deregulierung, so dass ihn zu große Transparenz oder Kontrolle lähmen und teilweise zerstören würde. Immerhin gibt es in diesem Bereich jedoch entsprechende Ansätze wie z.B. die Satzung, welche der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V. sich 2013 gegeben hat und in dem die Mitglieder nicht nur dazu verpflichtet werden, den von der europäischen Dachorganisation „Federation of European Art Galleries Association“ ausgearbeiteten „Code of Ethics and Professional Practices“ zur Wahrung der Seriosität kunsthändlerischer Arbeit im nationalen und internationalen Bereich zu befolgen, sondern sich auch bewusst zu halten, dass Kunsthandelnde nicht nur Kaufleute sind, sondern „als Vermittler originaler Kunstwerke auch eine kulturelle Aufgabe“ wahrnehmen: „Das Verhältnis zwischen Galerist/ Editeur / Kunsthändler und Kunstkäufer ist somit von einem besonders hohen Maß an Vertrauen geprägt.“
Dazu gehören als Maßnahme auch juristisch einklagbare kunsthistorische Sorgfaltspflichten bei der Prüfung zentraler Qualitätskriterien wie Echtheit, Zustand und Herkunft. Den Versuch, hinweisgebende Personen zu schützen, gibt es auch hier, wie z.B. die 2005 auf Initiative des Bundesverbandes Deutscher Kunstversteigerer (BDK) und des Auktionators Markus Eisenbeis von den „Van Ham Kunstauktionen“ eingerichtete „Datenbank kritischer Werke“ zeigt: Der Zugriff auf die Datenbank ist auf Mitglieder beschränkt, so dass intern Informationen zu
Vergegenwärtigt man sich abschließend die Folgen, welche
Fälschungen in Kunst und Wissenschaft zeitigen können, so wird
auch die Notwendigkeit deutlich, sich ihrer anzunehmen. Denn
jenseits des wirtschaftlichen Schadens (im Falle der
Kunstfälschungen wird der Kunstmarkt geschädigt, zudem kostet
die Aufklärung und juristische Aufarbeitung der Fälle
Steuergelder) sowie auch eines ideellen Schadens im Bereich der
Kunst (einmal gefälschte Künstlernamen können für den Kunstmarkt
auf Jahre hinweg mit Misstrauen belegt sein), schüren
Fälschungen in Kunst und Wissenschaft die Wissenschaftsskepsis –
mit wiederum problematischen Konsequenzen. Denn Fälschungen
produzierende bzw. auf Fälschungen hereinfallende
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können zur Folge haben,
dass divergierende Expertenmeinungen zu kontroversen Themen wie
z.B. dem Klimawandel ebenso wie wissenschaftliche Ergebnisse
generell in Frage gestellt bzw. sie, insbesondere, wenn dies
politisch opportun ist, als „fake science“ abgewertet werden.
Der 1950 geborene amerikanische Historiker Anthony Grafton vermochte 1990 immerhin, Fälschungen wenigstens den Vorteil zuzugestehen, dass sie als Motor des Fortschritts in den jeweiligen Disziplinen fungieren können: Indem zwischen Fälschenden und Fachleuten ein beständiger Wettlauf darum stattfindet, wer von ihnen jeweils die Nase vorne hat, was die Täuschung bzw. Entlarvung des jeweils anderen angeht, treiben sie zugleich das jeweilige Wissensgebiet voran.
Was im Rahmen unseres kurzen Projektes nicht geklärt werden
konnte, sich jedoch vor dem Hintergrund der eben in den Blick
genommenen Folgen zu untersuchen lohnen würde, sind weitere
Fragen: Ließen sich die hier angerissenen unterschiedlichen
Strategien der Konzeption, Distribution, Entlarvung und
Prävention von Fälschungen noch auf weitere Disziplinen und
Felder verallgemeinern? Und inwiefern sagen sie etwas über die
(verschiedenen) Authentizitätskonzepte in den jeweiligen
Wissenschaften aus?
Künftig weiter zu verfolgende, mögliche Ziele könnten dabei sein, dementsprechend nicht nur einen Überblick über die zur Anwendung kommenden Strategien in anderen Disziplinen zu bekommen, sondern auch hier die jeweiligen Ursachen und Motivationen der Akteure zu erforschen. Auf dieser Basis ließen sich dann eventuell weitere Methoden zur allgemeineren Entlarvung bzw. präventiven Vermeidung von Fälschungen entwickeln und diskutieren.
